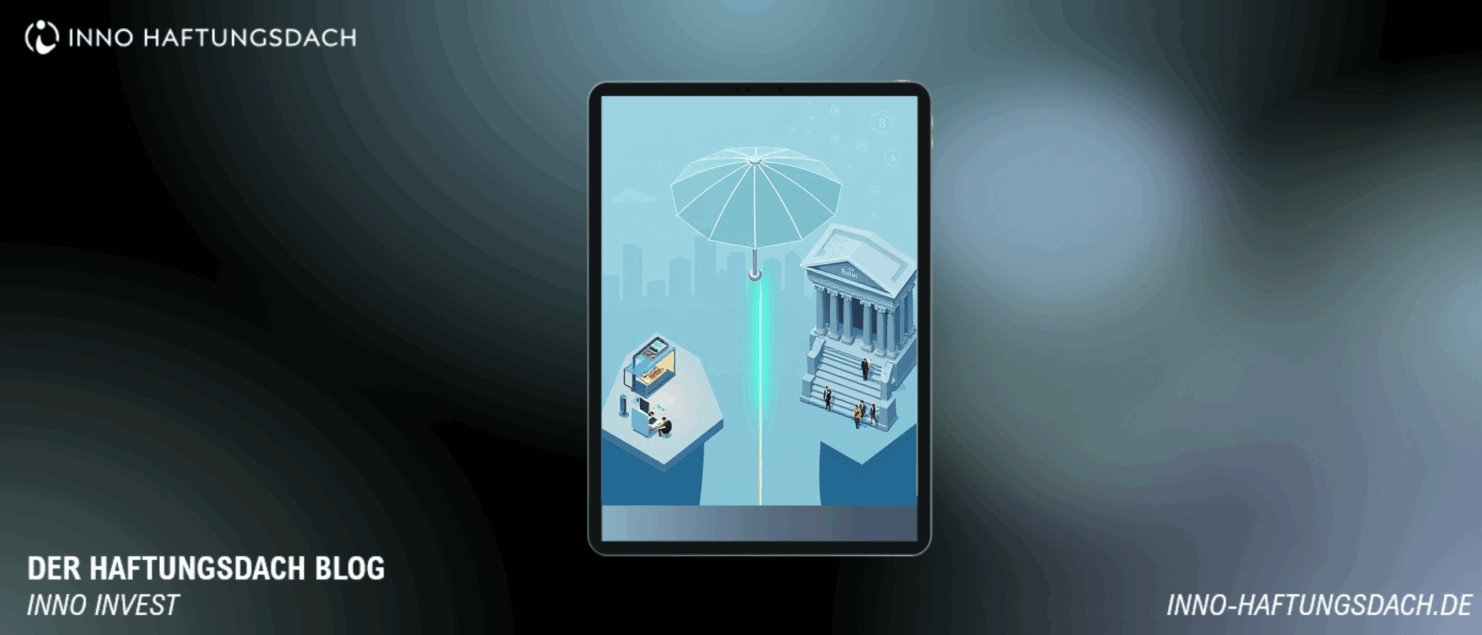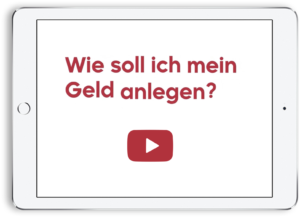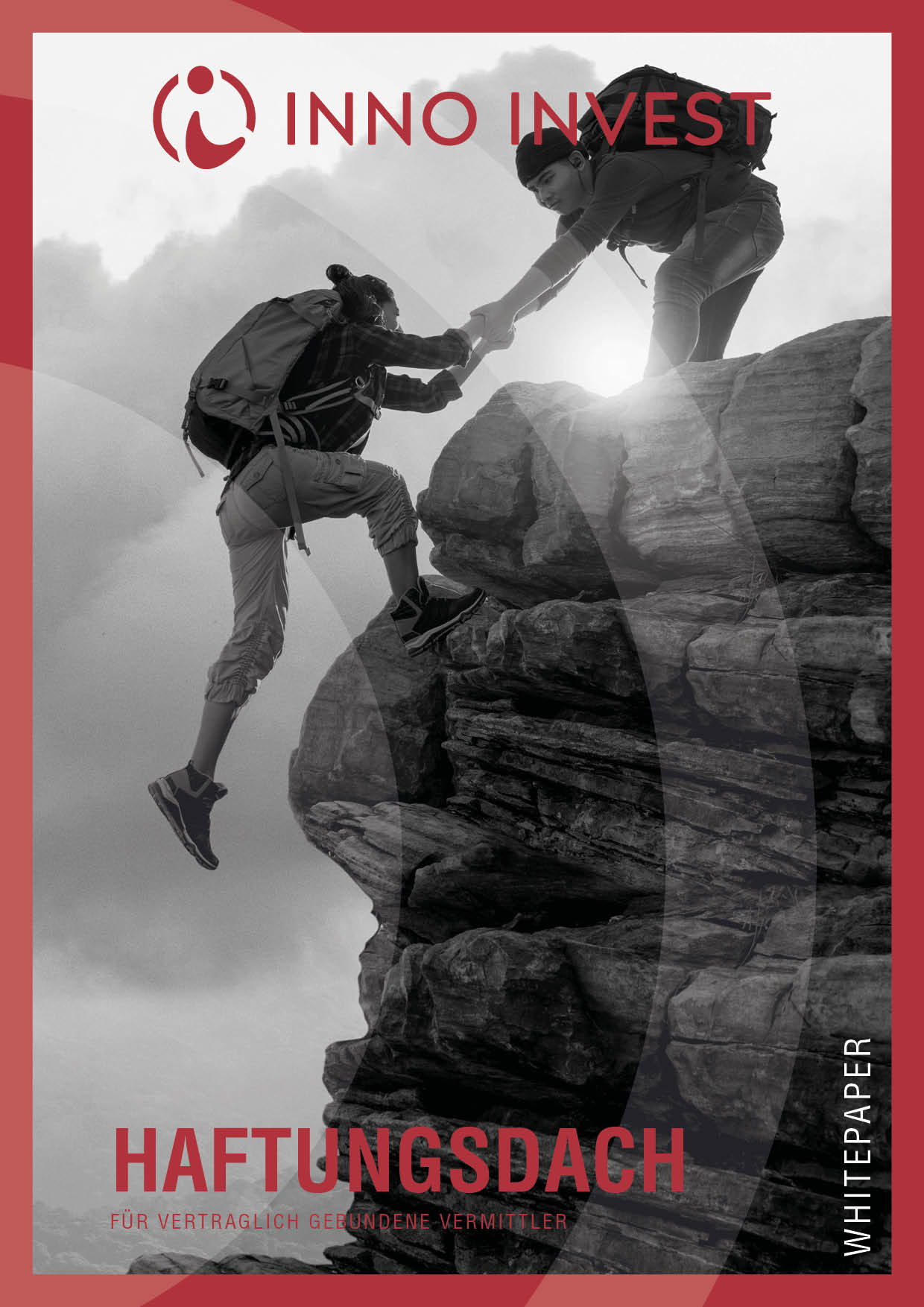Haftungsdach: Lohnt sich die Investition?
In der zunehmend komplexen und regulierten Welt der Finanzdienstleistungen stehen viele Anlageberater, Vermögensverwalter und Fintechs vor einer grundlegenden strategischen Entscheidung: Sollen sie unter einem Haftungsdach arbeiten oder eine eigene BaFin-Lizenz anstreben? Diese Frage ist nicht nur eine juristische oder regulatorische, sondern hat weitreichende Auswirkungen auf Geschäftsmodell, Kostenstruktur und unternehmerische Freiheit.
Insbesondere durch die kontinuierliche Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch EU-Richtlinien wie MiFID II und die zunehmende Digitalisierung der Branche hat die Debatte um die optimale regulatorische Struktur neue Relevanz gewonnen. Diese bewährte Lösung, als etabliertes Modell in der deutschen Finanzlandschaft, bietet eine Alternative zur eigenen BaFin-Lizenz, die besonders für Existenzgründer, kleinere Beraterteams und spezialisierte Finanzdienstleister attraktiv sein kann.
In dem folgenden Artikel betrachten wir die Vor- und Nachteile dieser Konstruktion, analysieren aktuelle Kostenstrukturen und geben konkrete Entscheidungshilfen für Finanzdienstleister, die vor dieser wichtigen strategischen Weichenstellung stehen. Unsere Kosten-Nutzen-Analyse hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, die Ihrem Geschäftsmodell, Ihren Ressourcen und Ihren langfristigen Zielen entspricht.
Was ist ein Haftungsdach und wie funktioniert es?
Diese aufsichtsrechtliche Konstruktion ermöglicht es Finanzdienstleistern, unter der Lizenz eines bereits BaFin-regulierten Instituts tätig zu werden. Rechtlich gesehen werden die Vermittler als „vertraglich gebundene Vermittler“ (Tied Agents) gemäß § 3 Abs. 2 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) klassifiziert.
Das Grundprinzip ist einfach: Der Vermittler schließt einen Vertrag mit dem Anbieter und kann dann im Namen und auf Rechnung der regulierten Gesellschaft Finanzdienstleistungen wie Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Platzierungsgeschäfte anbieten, ohne selbst eine BaFin-Lizenz zu benötigen. Das übergeordnete Institut übernimmt die aufsichtsrechtliche Verantwortung, stellt die regulatorische Compliance sicher und haftet gegenüber den Kunden und der Aufsichtsbehörde.
Die konkrete Ausgestaltung kann je nach Anbieter variieren. Typischerweise umfasst die Zusammenarbeit mit diesem Modell:
Die Nutzung der BaFin-Lizenz des Anbieters
- Compliance-Management und regulatorische Unterstützung
- Technische Infrastruktur und Back-Office-Support
- Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
- Schulungen und fachliche Unterstützung
- Gemeinsame Marketingaktivitäten (bei manchen Anbietern)
Von Bedeutung ist an dieser Stelle das Verständnis dahingehend, dass der vertraglich gebundene Vermittler nicht völlig frei am Markt agieren kann. Er muss sich an die Prozesse und Richtlinien des Anbieters halten und arbeitet zwar selbstständig, aber unter dessen „Dach“.
Die Marktentwicklung: Aktuelle Zahlen und Trends
Die Bedeutung dieser Lösung im deutschen Finanzmarkt hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Laut aktuellen Branchendaten gibt es in Deutschland aktuell über 19.500 vertraglich gebundene Vermittler, die unter solchen Konstruktionen arbeiten. Im Vergleich zu den etwa 39.000 Finanzanlagenvermittlern mit eigener Gewerbeerlaubnis nach § 34f GewO stellen sie damit einen erheblichen Anteil der Beraterschaft dar.
Ein besonders bemerkenswerter Trend ist die zunehmende Konsolidierung im Markt dieser Anbieter. Anfang 2025 ist die Deutsche Haftungsdach (DHD) GmbH durch eine Umstrukturierung aus der Fondsdepot Bank hervorgegangen und positioniert sich nun als größter Anbieter in Deutschland. Diese Konsolidierung spiegelt den wachsenden Professionalisierungsgrad und die zunehmende Bedeutung des Tied Agent Modells im Finanzsektor wider.
Die Nachfrage nach solchen Lösungen wird durch mehrere Faktoren getrieben:
- Regulatorische Komplexität: Die stetig steigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen machen es für einzelne Berater immer schwieriger, alle Compliance-Aspekte eigenständig zu bewältigen.
- Digitalisierungsdruck: Insbesondere Fintechs und technikaffine Berater benötigen moderne digitale Infrastrukturen, die diese Anbieter zunehmend bereitstellen.
- Spezialisierung: Vermittler konzentrieren sich verstärkt auf ihre Kernkompetenzen wie Beratung und Kundenbetreuung und lagern regulatorische und administrative Aufgaben aus.
Interessanterweise zeigt eine aktuelle Studie von 2024, dass von den Finanzanlagenvermittlern, die eine Entscheidung für die Zukunft ihres Geschäftsmodells treffen müssen, etwa 20% unter ein solches System schlüpfen wollen. Nur rund 12% planen, ihre Lizenz ganz aufzugeben – deutlich weniger als die von Branchenexperten zuvor erwarteten 40%. Dies unterstreicht die wachsende Akzeptanz und Attraktivität des vertraglich gebundenen Vermittler-Modells.
Kostenfaktoren: Tied Agent Lösung vs. eigene BaFin-Lizenz
Bei der Entscheidung zwischen dieser Alternative und einer eigenen BaFin-Lizenz spielt die Kostenstruktur eine zentrale Rolle. Hier eine detaillierte Gegenüberstellung der wichtigsten Kostenfaktoren im Jahr 2024/2025:
Kosten für die eigene BaFin-Lizenz
Die eigene BaFin-Lizenz erfordert erhebliche Investitionen:
- Anfangskapital: Mindestens 50.000 Euro müssen als Eigenkapital nachgewiesen werden
- Laufende Eigenkapitalanforderungen: Nach der Capital Requirements Regulation (CRR) müssen kontinuierlich ausreichende Eigenmittel vorgehalten werden
- Personal: Mindestens zwei qualifizierte Geschäftsleiter mit umfassender Erfahrung sind erforderlich
- BaFin-Gebühren: Jährliche Umlagen an die BaFin, die sich nach der Bilanzsumme bzw. dem Ertrag richten
- Compliance-Kosten: Ausgaben für die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen, einschließlich IT-Systeme und Dokumentation
- Prüfungskosten: Jährliche Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer
Nach Branchenschätzungen belaufen sich die jährlichen Kosten für die Aufrechterhaltung einer eigenen BaFin-Lizenz auf mindestens 100.000 bis 200.000 Euro, abhängig von der Größe und Komplexität des Unternehmens. Die einmaligen Kosten für die Erlangung der Lizenz liegen im mittleren fünfstelligen Bereich.
Kosten für die vertraglich gebundene Vermittlung
Die Kostenstruktur bei diesen Anbietern ist typischerweise mehrstufig:
- Einstiegsgebühr/Einmalkosten: Je nach Anbieter zwischen 0 und 10.000 Euro
- Fixe monatliche Grundgebühr: Zwischen 500 und 2.500 Euro monatlich, abhängig vom Servicelevel
- Variable Gebühren: Meist als Prozentsatz der Provisionen oder des verwalteten Vermögens, typischerweise zwischen 5% und 30%
- Zusatzleistungen: Optionale Dienste wie erweiterte IT-Lösungen, Marketingunterstützung oder spezielle Schulungen werden oft separat berechnet
Viele Anbieter bieten gestaffelte Pakete an, die unterschiedliche Servicelevels zu entsprechenden Preisen anbieten. Die Bank für Vermögen beispielsweise hat drei verschiedene Stufen mit einem „All-in-Preis“, der alle notwendigen Leistungen umfasst, die bei einer Einzel-BaFin-Lizenz separat bezogen werden müssten.
Wirtschaftlicher Vergleich
Für einen typischen Finanzdienstleister mit einem verwalteten Vermögen von 20 Millionen Euro und Jahresumsätzen um 200.000 Euro ergeben sich folgende wirtschaftliche Überlegungen:
Bei einer eigenen BaFin-Lizenz müssten jährlich mindestens 100.000 Euro für Compliance, Personal und Aufsichtskosten aufgewendet werden
Unter diesem Modell lägen die jährlichen Grundkosten bei etwa 18.000 bis 30.000 Euro plus variable Kosten von ca. 10.000 bis 60.000 Euro, je nach Geschäftsmodell und Vergütungsstruktur
Für kleinere und mittlere Dienstleister ergibt sich damit häufig ein Kostenvorteil zugunsten der vertraglich gebundenen Vermittlung. Ab einem kritischen Volumen – meist im Bereich von 50-100 Millionen Euro verwaltetem Vermögen – kann sich jedoch das Verhältnis zugunsten einer eigenen Lizenz verschieben.
Vorteile der vertraglich gebundenen Vermittlung
Die Entscheidung für diese Lösung bietet eine Reihe substanzieller Vorteile, die für viele Finanzdienstleister ausschlaggebend sein können:
1. Geringere Einstiegshürden und reduzierter regulatorischer Aufwand
Besonders für Berufseinsteiger, Existenzgründer und kleinere Teams ist der Zugang zum Markt über diese Konstruktion deutlich einfacher zu realisieren. Die hohen Anforderungen einer eigenen BaFin-Lizenz – insbesondere das Erfordernis zweier Geschäftsleiter und die Eigenkapitalanforderungen – entfallen. Dies ermöglicht einen schnelleren und kostengünstigeren Markteintritt.
Ein entscheidender Vorteil ist zudem die Auslagerung der komplexen Compliance-Anforderungen. Der Anbieter übernimmt die Erfüllung aller MiFID II-Auflagen, die Kommunikation mit der BaFin, das Reporting und die Dokumentation sowie die Einhaltung der WpHG-Vorschriften. Diese Entlastung ermöglicht es dem Vermittler, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren – die Beratung und Betreuung seiner Kunden.
2. Professionelle Infrastruktur und Kostenvorteile
Moderne Anbieter bieten eine umfassende technische und organisatorische Infrastruktur. Dazu gehören digitale Beratungs- und Dokumentationsplattformen, CRM-Systeme zur Kundenverwaltung, Zugang zu Produktanalysetools und Back-Office-Unterstützung. Besonders attraktiv ist dies für technikaffine Berater und Fintechs, die von der digitalen Infrastruktur eines etablierten Anbieters profitieren können, ohne selbst investieren zu müssen.
Darüber hinaus bündeln diese Plattformen die Ressourcen vieler Vermittler und können dadurch Skalenvorteile erzielen. Dies wirkt sich positiv auf die Kosten für IT-Systeme und deren Wartung, Schulungen und Weiterbildungen sowie den Zugang zu Rechtsberatung und Fachinformationen aus. Auch die Verhandlungsposition gegenüber Produktanbietern verbessert sich durch das größere Geschäftsvolumen.
3. Erweitertes Produktspektrum
Vertraglich gebundene Vermittler unter dieser Lösung können ein breiteres Spektrum an Finanzprodukten anbieten als beispielsweise Vermittler mit einer 34f-Erlaubnis. Die BaFin-Lizenz der übergeordneten Gesellschaft erlaubt die Vermittlung von Investmentfonds, Wertpapieren, strukturierten Produkten, Derivaten und weiteren Finanzinstrumenten. Diese Produktvielfalt kann ein wichtiger Wettbewerbsvorteil sein und eine ganzheitlichere Beratung der Kunden ermöglichen. Berater können ihren Klienten maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die über das begrenzte Spektrum einer reinen 34f-Erlaubnis hinausgehen, und dadurch ihre Beratungsqualität und Kundenbindung verbessern.
Nachteile und Einschränkungen der Tied Agent Lösung
Trotz der zahlreichen Vorteile ist dieses Modell nicht für jeden Finanzdienstleister die optimale Lösung. Es gibt einige wichtige Einschränkungen, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollten.
Die eingeschränkte Unabhängigkeit stellt für viele Vermittler eine bedeutende Herausforderung dar. Als vertraglich gebundener Vermittler agiert man im Namen und auf Rechnung der übergeordneten Gesellschaft. Dies bedeutet eine verpflichtende Einhaltung der Prozesse und Richtlinien des Anbieters, eine eingeschränkte Freiheit bei der Produktauswahl, da nur Produkte vermittelt werden können, die das System im Programm hat, sowie mögliche Einschränkungen bei der Markenbildung und Außendarstellung. Diese Faktoren können besonders für Berater problematisch sein, die großen Wert auf ihre absolute Unabhängigkeit legen oder sehr spezifische Anlagestrategien verfolgen möchten.
Aus langfristiger Kostenperspektive ergibt sich ein differenziertes Bild. Während die Einstiegskosten bei dieser Alternative niedriger sind, können die laufenden Kosten – insbesondere durch Provisionsabgaben – langfristig zu einer höheren Gesamtbelastung führen. Mit wachsendem Geschäftsvolumen steigen die variablen Kosten proportional, und ab einem bestimmten Volumen (meist 50-100 Millionen Euro verwaltetes Vermögen) kann eine eigene Lizenz wirtschaftlicher sein. Zudem schafft die Abhängigkeit von der Preisgestaltung des Anbieters ein gewisses Kostenrisiko, da Preiserhöhungen nur bedingt beeinflusst werden können.
Ein häufig übersehener Aspekt ist die Haftung im Innenverhältnis zwischen Vermittler und der regulierten Gesellschaft. Zwar haftet das übergeordnete Institut nach außen gegenüber Kunden und BaFin, im Innenverhältnis kann es jedoch Regress beim Vermittler nehmen. Die Vertragsbedingungen können weitreichende Verpflichtungen für den Vermittler beinhalten, die bei Fehlberatungen oder Compliance-Verstößen zu erheblichen finanziellen Risiken führen können. Diese potenziellen Regressansprüche sollten bei der Vertragsgestaltung sorgfältig geprüft werden.
Die Abhängigkeit vom Anbieter stellt eine weitere strategische Überlegung dar. Bei Problemen der übergeordneten Gesellschaft, sei es durch finanzielle Schwierigkeiten oder regulatorische Verstöße, kann die eigene Geschäftstätigkeit unmittelbar gefährdet sein. Ein Wechsel des Anbieters ist mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden und kann zu Unterbrechungen in der Kundenbetreuung führen. Darüber hinaus können Servicequalität und technische Infrastruktur nicht vollständig selbst bestimmt werden, was die eigene Geschäftsentwicklung beeinträchtigen kann.
Langfristige Wachstums- und Entwicklungsziele können unter diesem System ebenfalls eingeschränkt sein. Der Aufbau eines eigenständigen, verkaufsfähigen Unternehmenswertes gestaltet sich schwieriger, da die Kundenbeziehungen formal durch die übergeordnete Gesellschaft gehalten werden. Ebenso können sich Einschränkungen bei der internationalen Expansion ergeben, wenn das Dach-Unternehmen nicht über die entsprechenden Lizenzen in den Zielmärkten verfügt. Auch die Integration in komplexere Unternehmensstrukturen, etwa bei Fusionen oder Übernahmen, kann durch diese Bindung erschwert werden.
Entscheidungskriterien: Wann lohnt sich die vertraglich gebundene Vermittlung?
Die Frage, ob sich diese Lösung lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Vielmehr hängt die Entscheidung von verschiedenen individuellen Faktoren ab.
Das Geschäftsvolumen und -stadium des Unternehmens spielt eine entscheidende Rolle bei dieser Überlegung. Für Existenzgründer und Startups ist das Modell meist vorteilhaft, da die Einstiegshürden niedriger sind und die regulatorische Komplexität ausgelagert werden kann. Dies ermöglicht einen schnelleren Markteintritt ohne das erhebliche Anfangskapital, das für eine eigene Lizenz erforderlich wäre. Etablierte Berater mit mittlerem Volumen (ca. 20-50 Millionen Euro verwaltetes Vermögen) können ebenfalls von dieser Alternative profitieren, wenn die Kosteneinsparungen die Abgaben überwiegen. Die Fixkosten einer eigenen Lizenz würden hier noch zu stark ins Gewicht fallen. Für große Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen ab etwa 100 Millionen Euro wird eine eigene BaFin-Lizenz hingegen häufig wirtschaftlicher, da die proportional steigenden Gebühren an den Anbieter die Fixkosten der eigenen Lizenz übersteigen.
Die personellen und organisatorischen Ressourcen stellen einen weiteren entscheidenden Faktor dar. Kleine Teams mit ein bis drei Personen finden in der Auslagerung der Compliance und Administration an diesen Service meist die einzig praktikable Lösung, da die Mindestanforderungen für eine eigene Lizenz (zwei Geschäftsleiter, Compliance-Funktion, etc.) kaum erfüllbar sind. Bei mittleren Teams mit vier bis zehn Personen ist eine differenziertere Betrachtung notwendig. Die Entscheidung hängt hier stark von der Teamzusammensetzung und den vorhandenen Kompetenzen in den Bereichen Recht, Compliance und IT ab. Verfügt das Team bereits über entsprechende Fachkräfte, sinkt der Mehrwert der externen Lösung. Größere Teams mit mehr als zehn Mitarbeitern verfügen eher über die notwendigen Ressourcen, um eine eigene BaFin-Lizenz wirtschaftlich zu betreiben und die damit verbundenen Aufgaben intern abzudecken.
Das spezifische Geschäftsmodell und der Produktfokus beeinflussen die Entscheidung ebenfalls maßgeblich. Vermittler, die ein breites Spektrum an Finanzprodukten anbieten möchten, profitieren deutlich von der umfassenderen Lizenz dieser Anbieter im Vergleich zur eingeschränkten 34f-Erlaubnis. Sie können dadurch ein ganzheitlicheres Beratungskonzept umsetzen. Für spezialisierte Anbieter mit einem sehr spezifischen Fokus, beispielsweise nur auf bestimmte Fondsklassen, kann hingegen eine eigene, eingeschränkte Erlaubnis die bessere Option sein. Besonders attraktiv können moderne Plattformen für digitale Geschäftsmodelle und Fintechs sein, die von der technologischen Infrastruktur und den digitalen Prozessen profitieren, ohne selbst in teure IT-Systeme investieren zu müssen.
Die langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens sollten unbedingt in die Entscheidung einfließen. Für Berater, bei denen die vollständige Unabhängigkeit ein zentrales Marketingversprechen ist, kann eine eigene Lizenz trotz höherer Kosten strategisch sinnvoller sein, da sie ihre Unabhängigkeit glaubwürdig nach außen kommunizieren können. Bei ambitionierten Wachstumsplänen sollte der Zeitpunkt des Wechsels zu einer eigenen Lizenz frühzeitig in die Planung einbezogen werden, um den Übergang reibungslos zu gestalten. Die Exit-Strategie spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da die Verkaufbarkeit des Unternehmens unter diesem System eingeschränkt sein kann. Dies sollte bei entsprechenden Exit-Plänen berücksichtigt werden, um den Unternehmenswert zu maximieren.
Praktische Checkliste für die Entscheidungsfindung
Um die richtige Entscheidung für Ihr Unternehmen zu treffen, sollten Sie folgende Aspekte systematisch prüfen:
1. Wirtschaftliche Analyse
- Aktuelles und prognostiziertes Geschäftsvolumen für die nächsten 3-5 Jahre
- Detaillierte Kostenvergleichsrechnung zwischen den Alternativen und eigener Lizenz
- Break-Even-Analyse: Ab welchem Volumen wäre eine eigene Lizenz wirtschaftlicher?
- Liquiditätsanalyse: Können die notwendigen Anfangsinvestitionen für eine eigene Lizenz getragen werden?
2. Organisatorische Bewertung
- Verfügbarkeit qualifizierter Geschäftsleiter (für eigene Lizenz)
- Vorhandene Kompetenzen in den Bereichen Compliance, Recht und IT
- Kapazitäten für regulatorisches Reporting und Dokumentation
- Möglichkeiten zur technischen Umsetzung der regulatorischen Anforderungen
3. Strategische Überlegungen
- Bedeutung der vollständigen Unabhängigkeit für das Geschäftsmodell
- Langfristige Wachstums- und Entwicklungsziele
- Mögliche Synergiepotenziale mit einem externen Anbieter (z.B. Zugang zu Kundenstämmen, IT-Infrastruktur)
- Exit-Strategie und Aufbau eines verkaufsfähigen Unternehmenswertes
4. Auswahl des richtigen Anbieters
Falls die Entscheidung für diese Alternative fällt, sollten bei der Auswahl folgende Kriterien beachtet werden:
- Reputation und Finanzstärke des Anbieters
- Umfang und Qualität der angebotenen Dienstleistungen
- Modernität der technischen Infrastruktur
- Transparenz der Kostenstruktur
- Flexibilität bei der Produktauswahl
- Möglichkeiten zur Wahrung der eigenen Markenidentität
Fazit: Die richtige Balance zwischen Kosteneffizienz und Unabhängigkeit
Die Entscheidung zwischen der vertraglich gebundenen Vermittlung und einer eigenen BaFin-Lizenz ist eine strategische Weichenstellung, die sorgfältig abgewogen werden sollte. Es zeigt sich, dass beide Modelle ihre Berechtigung haben – entscheidend ist der Bezug zum individuellen Geschäftsmodell, den verfügbaren Ressourcen und den langfristigen Zielen.
Für viele Existenzgründer, kleinere Teams und spezialisierte Anbieter bietet der Anschluss an diese Lösung einen attraktiven Weg, regulierte Finanzdienstleistungen anzubieten, ohne die erheblichen Einstiegshürden einer eigenen BaFin-Lizenz überwinden zu müssen. Die Kostenvorteile, die professionelle Infrastruktur und die Entlastung von regulatorischen Aufgaben können entscheidende Wettbewerbsvorteile darstellen.
Gleichzeitig sollten die Einschränkungen in Bezug auf die unternehmerische Unabhängigkeit, die langfristige Kostenentwicklung und die strategischen Implikationen nicht unterschätzt werden. Eine transparente Kostenanalyse und eine ehrliche Bewertung der eigenen organisatorischen Fähigkeiten sind unerlässlich.
In vielen Fällen erweist sich ein stufenweiser Ansatz als sinnvoll: Der Start unter diesem System ermöglicht einen schnellen und kostengünstigen Markteintritt. Mit wachsendem Geschäftsvolumen, zunehmender Erfahrung und entsprechenden finanziellen Ressourcen kann dann zu einem späteren Zeitpunkt der Übergang zu einer eigenen BaFin-Lizenz erfolgen.
Letztendlich geht es darum, die optimale Balance zwischen Kosteneffizienz, Unabhängigkeit und Compliance-Sicherheit zu finden – eine Balance, die so individuell ist wie Ihr Geschäftsmodell selbst. Mit der richtigen Strategie kann sowohl ein Haftungsdach als auch eine eigene Lizenz der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg in der Finanzbranche sein.
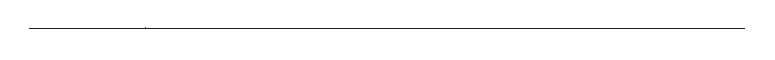
Über das Haftungsdach der INNO INVEST

Geschäftsführung: Herbert Schmitt (li)
und Stefan Schmitt (re)
Vermögensverwaltung | Haftungsdach
Als einer der modernsten Haftungsdach-Vermögensverwalter bietet die INNO INVEST neben der hauseigenen Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und Unternehmer auch die gesamte Wertschöpfungskette des Wealth Managements über ihre eigene Wealthtech-Plattform für externe Vermögensverwalter, Multi Family Offices und Anlageberater an. Mit Anbindungen an renommierte Depotbanken wie bspw. UBS, DAB BNP Paribas, V-Bank, Comdirect, FNZ, die österreichische easybank oder Interactive Brokers LLC. kooperiert INNO INVEST auch mit innovativen Produktplattformen wie Privatize oder Weltsparen by Raisin sowie mit ausgewählten Private Equity-Häusern. Aus Darmstadt heraus werden die Klassische sowie die Online-Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und Unternehmer, als Infrastruktur-Fintech die Wealthtech-Plattform für Investment-Fintechs und für vertraglich gebundene Vermittler ein professionelles Haftungsdach angeboten.
Entdecken Sie hier unsere Vermögensverwaltung: